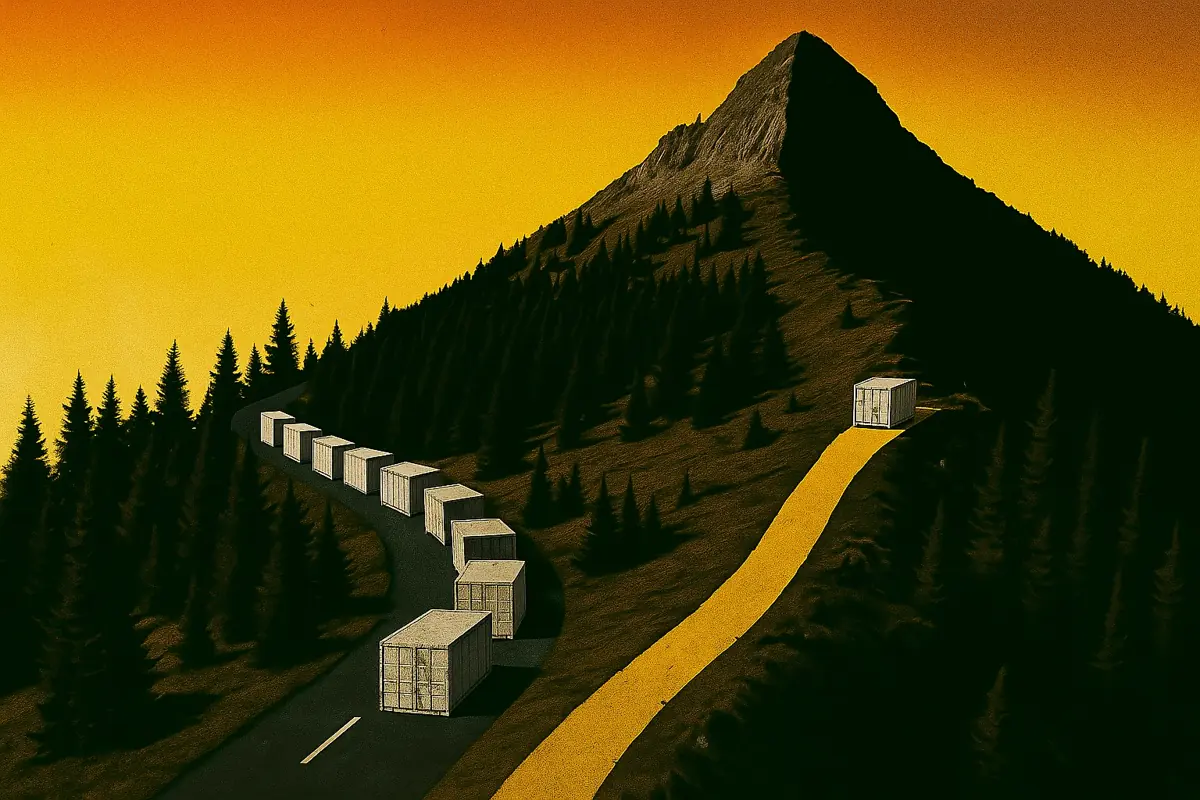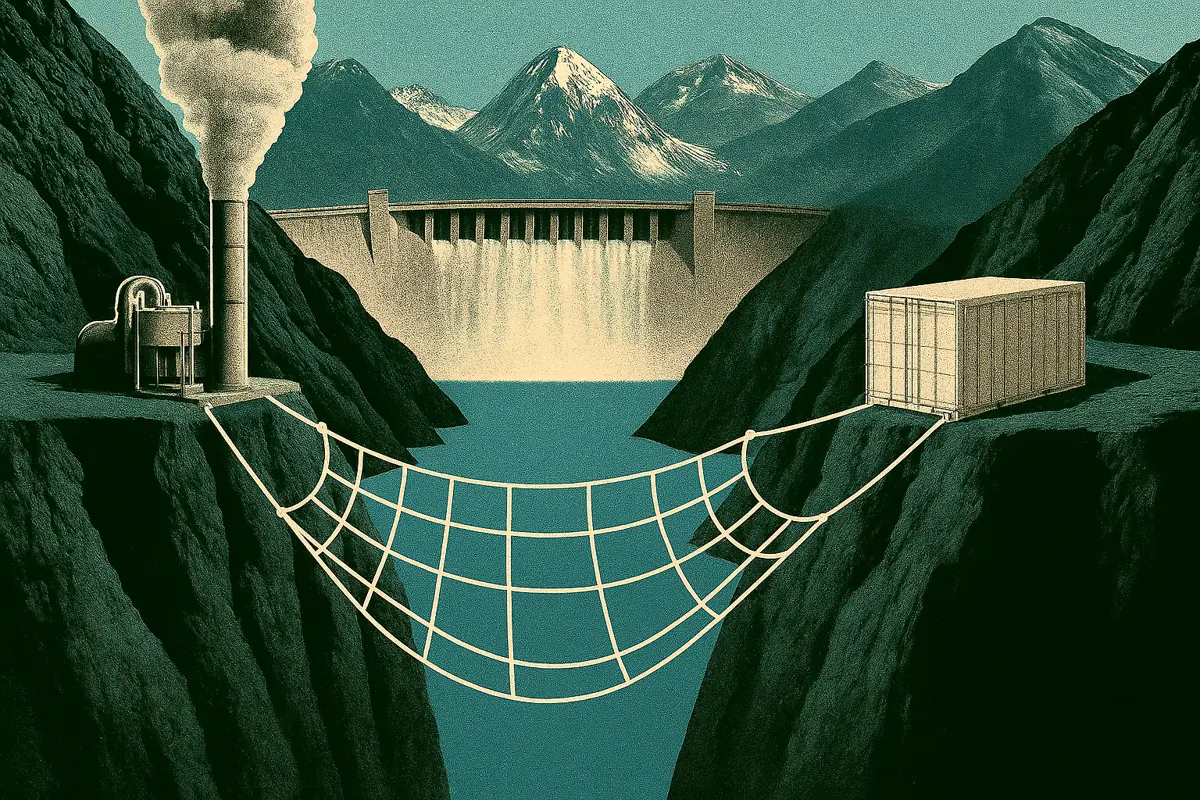Die installierte Solarkapazität hat 100 GW überschritten. Doch die sommerliche Spitzenlast liegt selten über 60 GW. An sonnigen Tagen überschwemmt Solarenergie den Markt und drückt die Preise auf ein Minimum.
Die Auswirkungen zeigen sich bereits in der Wirtschaftlichkeit von Merchant-Projekten.
Aber 90 % der Projekte in Deutschland werden durch Festpreissubventionen abgesichert – und diese Zahlungen werden aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Was muss Deutschland also tun, um Verbraucher zu schützen und den langfristigen Wert von Solarenergie im System zu sichern?
Diese Analyse untersucht:
- Wie Deutschlands Solar-Capture-Rate in weniger als drei Jahren von 98 % auf 54 % gefallen ist.
- Warum die Sommerproduktion fünfmal schneller wächst als im Winter.
- Wie steigende Produktion die Merit-Order verändert.
- Warum Deutschlands jährliche Capture-Rate inzwischen der Spaniens entspricht.
- Was das für die Gestaltung von Subventionen und die Wirtschaftlichkeit von Speicherlösungen bedeutet.
Für weitere Informationen zu diesem Thema kontaktieren Sie den Autor – zach.williams@modoenergy.com
Die deutschen Solar-Capture-Raten sind um 44 % gesunken
Die Solar-Capture-Rate misst den durchschnittlichen Preis, den Solaranlagen im Vergleich zum Gesamtmarktpreis erzielen.
Im bisherigen Jahr 2025 lag dieser Wert im Schnitt nur bei 54 % – gegenüber 98 % im Jahr 2022.
Ein klar saisonales Muster ist erkennbar: Im Mai und Juni sanken die monatlichen Capture-Raten auf nur 0,43 und 0,44.
Der Sommer wird immer mehr zur entscheidenden Phase für die Projektwirtschaftlichkeit.
Die Sommerproduktion wächst fünfmal schneller als im Winter
Im vergangenen Jahr entfielen 43 % der Solarproduktion auf nur drei Monate – Juni, Juli und August.
Deutschlands hohe geografische Breite und die südorientierte Modulaufstellung führen dazu, dass jedes neue Gigawatt installierter Kapazität im Sommer fünfmal mehr Strom erzeugt.
Während die Nachfrage jährlich um etwa 1 GW sinkt, steigt die Solarspitzenleistung um 3 GW.
Mehr Solarstrom trifft auf geringere Last und deckt die Nachfrage immer häufiger ab.
Diese Dynamik verschärft den Druck auf die Wirtschaftlichkeit:
- Solar wird immer öfter zum Grenzproduzenten und drückt die Preise.
- Mehr Energie wird zu diesen niedrigeren Preisen verkauft.
Letztlich sinken die Capture-Raten, weil mehr Energie zu Zeiten verkauft wird, in denen Solar den Preis bestimmt. Das ist Solare Kannibalisierung.
Solar bestimmt immer öfter den Marktpreis
Der deutsche Day-Ahead-Markt ist eine Pay-as-cleared-Auktion. Erzeuger bieten im Wesentlichen entsprechend ihrer Kosten, und die günstigsten Gebote werden angenommen, bis die Nachfrage gedeckt ist.
Der Mindestpreis im Markt liegt bei -500 €/MWh. Must-run-Anlagen und geförderte Erneuerbare bieten oft auf diesem Niveau, um sicher zum Zug zu kommen.
In den letzten fünf Jahren haben weitere 11 GW tagsüber zu negativen Preisen geboten.
Nachts sieht die Angebotsstruktur aus wie 2020 – der Wandel ist also vor allem auf neue geförderte Solarkapazitäten zurückzuführen.
Mit wachsender installierter Kapazität verdrängt Solar immer häufiger thermische Kraftwerke als Grenzproduzenten. Sobald die letzte thermische Einheit abgeschaltet ist, können die Preise abrupt um 100 €/MWh oder mehr fallen.
Und der Preisverfall beschleunigt sich
Die Capture-Raten fielen 2022 elfmal unter 50 %, 2023 bereits 31-mal und 2024 schon 63-mal. Sie verdoppeln sich jedes Jahr.
Dies ist kein linearer Trend. Jedes Jahr verstärkt mehr Solar die Zahl der Tage, an denen die Einnahmen einbrechen.
Deutschland hat weniger Solar als Spanien, aber ähnlich niedrige Capture-Raten
Der Anteil von Solar in Spanien ist fast doppelt so hoch wie in Deutschland: 18 % vs. 10 %.
Trotzdem sind die jährlichen Capture-Raten nahezu identisch.
Es liegt an Saisonalität und Nachfrageprofil
Spaniens Lage näher am Äquator sorgt für ein gleichmäßigeres Erzeugungsprofil über das Jahr als das deutsche.
Auch die Nachfragemuster unterscheiden sich:
- In Spanien treibt Sommerhitze die Nachfrage nach Klimaanlagen und hilft, das Mittagsangebot aufzunehmen.
- In Deutschland ist die Nachfrage flacher, mit nur einem moderaten Winterpeak durch Heizung.
In Spanien sinken die Capture-Raten in den Übergangszeiten, halten sich aber im Sommer besser und profitieren sogar von einer ordentlichen Winterproduktion, wenn die Preise höher sind.
Warum wird in Deutschland weiter Solar gebaut, obwohl die Renditen schrumpfen?
Weil der Großteil der deutschen Solaranlagen vom Marktgeschehen abgeschirmt ist.
Über 90 % der installierten Kapazität werden staatlich gefördert – entweder durch Einspeisevergütungen (EEG) oder Marktprämien. Diese Modelle sichern die Einnahmen auch bei Preisverfall ab.
Seit 2017 ist Deutschland für den Großteil des Zubaus von festen Fördersätzen auf wettbewerbliche Ausschreibungen umgestiegen.
Da die Ausschreibungsrunden überzeichnet sind, setzen manche Entwickler inzwischen auf PPAs oder Merchant-Modelle.
Neue Negativpreis-Regeln ab 2021 und ein wachsender Merchant-Anteil bedeuten, dass ein kleiner, aber wachsender Teil der Solarenergie nun Marktrisiken ausgesetzt ist.
Doch die Mehrheit der installierten Kapazität ist durch Altförderungen geschützt – und diese Kosten werden aus dem Bundeshaushalt getragen.
Mit sinkenden Capture-Raten wächst die Förderlücke.
Das erhöht den Druck auf weitere Reformen und macht Speicher zur zentralen Säule für langfristige Investitionen.
Fazit: Der Wert von Solar sinkt – aber der Speicherbedarf war nie größer
Deutschland baut Solar schneller aus, als das Netz aufnehmen kann – das drückt die Capture-Raten und erhöht die Förderkosten.
Mit dem Ziel von 215 GW bis 2030 wird sich dieses Missverhältnis noch verstärken.
Die Fundamentaldaten sprechen klar für Batteriespeicher.
Ein Netz, das mittags mit günstigem Strom geflutet wird, schafft ideale Bedingungen für Speicher – Strom kann bedarfsgerecht verschoben, Kosten gesenkt und die Systemeffizienz erhöht werden.
Davon profitieren die Verbraucher – und es entsteht ein attraktives Geschäftsmodell.
Batterien können Förderzahlungen reduzieren und gleichzeitig voll merchant-basierte Erträge erzielen – privates Kapital wird so in die Energiewende gelenkt.
Bis Jahresende werden 3 GW Batteriespeicher erwartet – das reicht aber nicht, um mit dem Solarausbau Schritt zu halten.
Die Frage ist nun, ob Speicher schnell genug ausgebaut werden können, um die Investitionsgrundlage für Solar zu retten.