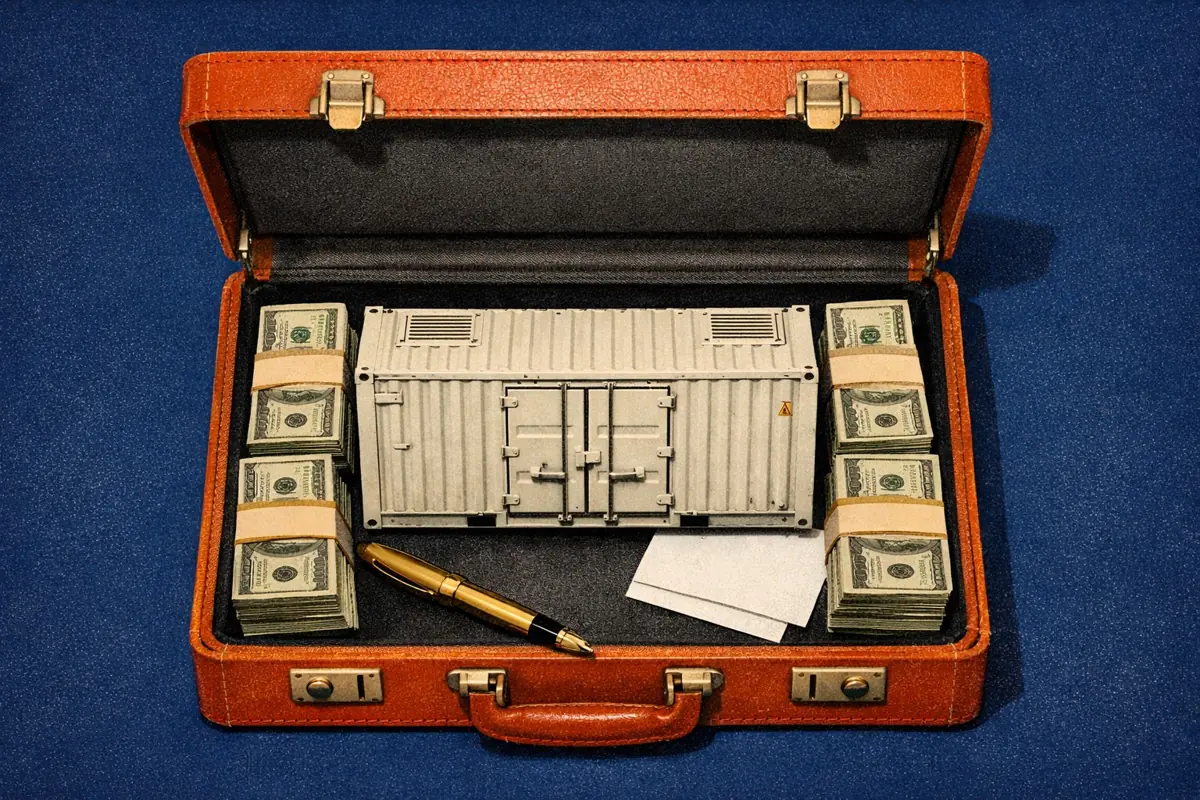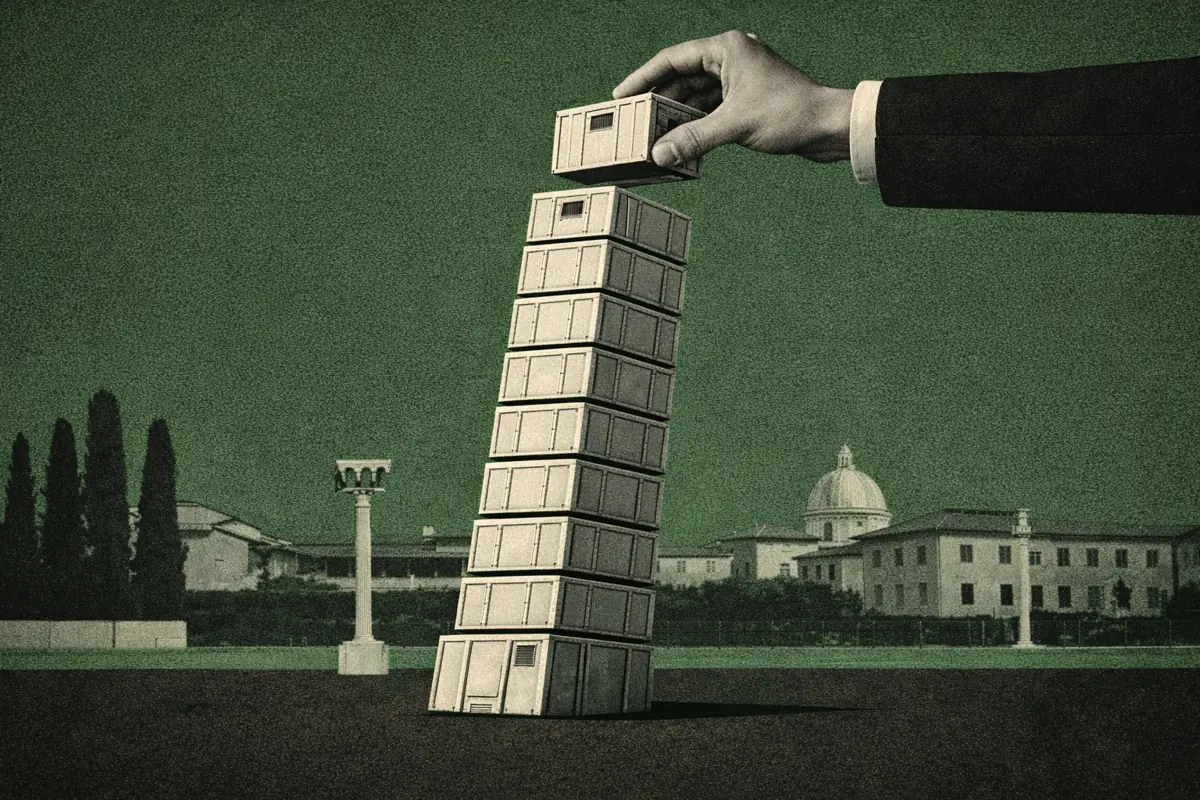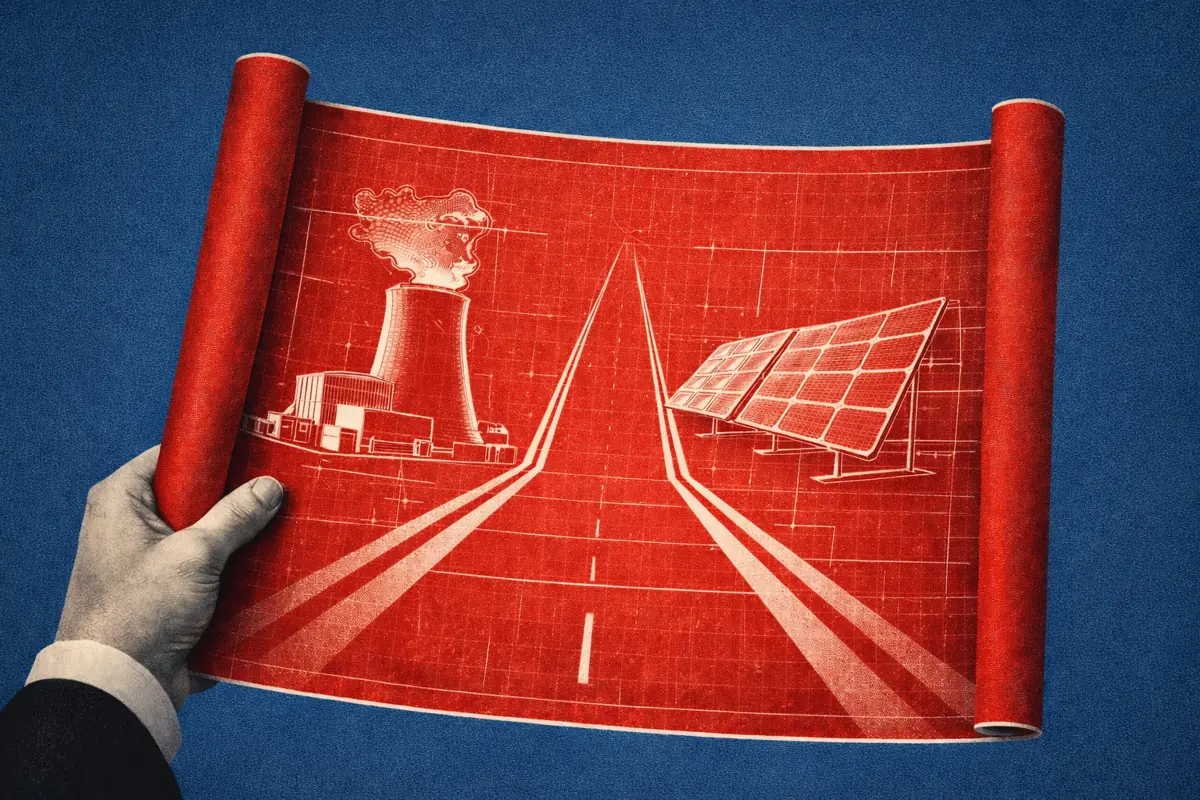Kopplung von Batteriespeichern: AC/DC-Kopplung
Für die gemeinsame Nutzung von Speichern gibt es keine Universallösung. Es existieren zahlreiche technische Ansätze, die jeweils die betrieblichen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Projekts verändern. Doch wie geht man konkret vor, um ein Batteriespeichersystem mit einer Erzeugungsanlage zu kombinieren?
In unserem vorherigen Artikel zur gemeinsamen Nutzung haben wir das Konzept vorgestellt, Batteriespeicher direkt neben Erzeugungsanlagen zu platzieren. In diesem Beitrag gehen wir ins Detail, wie ein solches Projekt konkret aufgebaut werden kann. Der Fokus liegt auf der Kombination von Photovoltaik und Speicher, wobei einige Aspekte auch für andere Formen der Kopplung gelten.
Spoiler-Alarm
- AC-Kopplung ist die am weitesten verbreitete Methode für die Kombination von Projekten. Hierbei wird der Speicher auf der AC-Seite des Wechselrichters an die Erzeugung angeschlossen, noch bevor der Netzanschluss erreicht wird.
- DC-Kopplung stellt eine Alternative für Solar- und Speicherprojekte dar. Die Batterie wird auf der DC-Seite beider Anlagen mit der Solaranlage verbunden. Beide Anlagen teilen sich dann einen gemeinsamen Wechselrichter.
- Beide Lösungen führen zu Einschränkungen beim Betrieb des Batteriespeichers. Grund dafür ist, dass der gemeinsame Netzanschluss in der Regel keinen gleichzeitigen Vollexport von Speicher und Erzeugung zulässt.
- Die Messung kann den Betrieb eines Projekts maßgeblich beeinflussen, indem Batterie und Erzeugung zusammengefasst oder voneinander getrennt werden.
Geteilte Netzanschlüsse – gemeinsam stark
Der gängigste Weg für die gemeinsame Nutzung von Speicher und Photovoltaik ist bislang die AC-Kopplung. Beide Anlagen werden auf der Wechselstromseite ihrer Wechselrichter gekoppelt – bevor der Strom ins Netz eingespeist wird.
Batteriespeicher laden und entladen Strom als Gleichstrom (DC). Auch viele erneuerbare Erzeugungsanlagen – wie Photovoltaik – arbeiten auf DC-Basis. Der Strom muss jedoch vor der Netzeinspeisung in Wechselstrom (AC) umgewandelt werden. Diese Aufgabe übernimmt der Wechselrichter.
Um die verschiedenen Kopplungsvarianten zu veranschaulichen, nehmen wir ein fiktives Solar- und Speicherprojekt am Modo-Hauptsitz im sonnigen Birmingham als Beispiel. Die technischen Eckdaten sind:
- Ein Netzanschluss mit 50 MW (Import und Export).
- Eine 50 MWh-Batterie mit einem 50 MW-Wechselrichter.
- Eine 70 MWp-Photovoltaikanlage mit einem 50 MW-Wechselrichter.
Fachbegriff erklärt: 70MWp bedeutet, dass die Solarmodule auf der DC-Seite des Wechselrichters bei Spitzenleistung 70 MW erzeugen.
Wie sieht unser AC-gekoppeltes Projekt aus?
Abbildung 1 (unten) zeigt beispielhafte Konfigurationen dieser drei Komponenten. Ein AC-gekoppeltes Solar- und Speicherprojekt wird mit zwei getrennten Einzelanlagen verglichen.

- Im ersten Beispiel gibt es zwei Einzelprojekte: ein Batteriespeicher und eine Solaranlage. Beide verfügen über eigene Netzanschlüsse.
- Im zweiten Beispiel werden beide Anlagen vor dem Netzanschluss zusammengeführt. Dadurch können Kosten für den Netzanschluss eingespart werden.
- In beiden Projekten begrenzt der Wechselrichter (clipping) die gesamte DC-Leistung der Solarmodule. Clipping bedeutet, dass die Solaranlage bei Spitzenleistung mehr Strom erzeugt, als der Wechselrichter umwandeln kann. Überschüssige Energie wird als Wärme abgeführt. Es ist üblich, die DC-Kapazität einer PV-Anlage größer als die Wechselrichterleistung auszulegen, um eine breitere Einspeisekurve – und damit einen höheren Nutzungsgrad und bessere Erträge – zu erzielen.
- Der Wechselrichter begrenzt die Solarleistung, bevor der Batteriespeicher angeschlossen wird. Dadurch kann die Batterie nicht mit dem überschüssigen Solarstrom geladen werden.
Kopplung bringt Einschränkungen mit sich
Die gemeinsame Nutzung beider Anlagen führt zu einer Begrenzung der Exportkapazität. Wenn die Solaranlage Strom erzeugt und über einen einzigen Anschluss einspeist, verringert sich der verbleibende Exportspielraum für die Batterie.
Das bedeutet, dass Batterie und Solaranlage nicht gleichzeitig mit voller Leistung einspeisen können. Da die Batterie flexibler ist, wird in der Praxis meist deren Betrieb an diese Einschränkung angepasst.
Abbildung 2 (unten) zeigt, wie die Solarproduktion die Exportkapazität der Batterie beeinflusst.

- Nachts kann der Batteriespeicher mit voller Leistung einspeisen, da die Solaranlage keinen Strom liefert und der Netzanschluss 50 MW Spielraum bietet.
- Mittags speist die Solaranlage mit voller Leistung ein, sodass kein Spielraum für die Batterie bleibt.
- Dies führt zu betrieblichen Einschränkungen beim Batteriespeicher und wirkt sich auf die Teilnahme an Systemdienstleistungen aus.
- Der Wechselrichter begrenzt das nicht-geclippte Solarprofil auf 50 MW. Zusätzlich gehen durch Umwandlungsverluste weitere Energiemengen verloren.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Um den sicheren Betrieb einer AC-gekoppelten Anlage zu gewährleisten, sind Hard- und Softwarelösungen zur Exportbegrenzung notwendig. Im Beispiel übersteigt die gemeinsame Exportleistung von Solar und Batterie (100 MW) die verfügbare Netzkapazität (50 MW). Wird dieser Wert überschritten, kann der Netzbetreiber eine Abschaltung verlangen. Häufig ist in den Netzanschlussverträgen festgelegt, dass die Anlage bei Überschreitung automatisch abgeschaltet wird (G99-Zertifizierung für den Anschluss an das lokale Netz).
Dies ist mit Kosten verbunden – sowohl durch entgangene Einspeisung während der Abschaltung als auch durch mögliche Strafzahlungen des Netzbetreibers. Daher muss die Lösung vor Ort zuverlässig sicherstellen, dass Import- und Exportgrenzen nicht überschritten werden.
DC-Kopplung: der heilige Gral der Kopplung?
Im oberen Abschnitt wurde die AC-Kopplung beschrieben. Es gibt jedoch eine weitere Lösung für Solar- und Speicherprojekte: die DC-Kopplung. Bei einer DC-gekoppelten Anlage erfolgt die Verbindung beider Komponenten hinter einem gemeinsamen Wechselrichter.
Abbildung 3 (unten) zeigt, wie dies für unser Beispielprojekt aussehen würde.

- Dies ist aus technologischer Sicht die effizienteste Lösung, da nur ein Wechselrichter und ein Netzanschluss benötigt werden.
- Die Batterie ist jetzt gemeinsam mit der Solaranlage hinter dem Wechselrichter angeschlossen und kann somit direkt mit Solarstrom geladen werden – auch mit Strom, der sonst durch Clipping verloren gehen würde.
- Die DC-gekoppelte Anlage unterliegt denselben Einschränkungen wie die AC-gekoppelte – allerdings am Wechselrichter statt am Netzanschluss. Somit kann physikalisch nie mehr als die erlaubte Netzkapazität eingespeist werden.
- Dadurch kann die DC-Kopplung aus Sicht des Netzbetreibers bevorzugt werden und in manchen Regionen sogar Vorrang beim Netzanschluss erhalten.
Wo liegt der Haken?
DC-Kopplung gilt oft als optimale Lösung für die Kombination von Solar und Speicher – aus den oben genannten Gründen. Dennoch sind die meisten bisher angekündigten Projekte im Vereinigten Königreich AC-gekoppelt. Warum?
- Obwohl ein gemeinsamer Wechselrichter Kosten sparen sollte, wurden die Kostenvorteile bei Speichern bisher vor allem durch die Entwicklung von Komplettlösungen („Containerlösungen“) erzielt. Diese Vorteile können durch die Entkopplung wieder verloren gehen.
- Die Leistung des Wechselrichters setzt sich aus Solar- und Batteriesignalen zusammen – einschließlich der Schwankungen im Solarprofil. Dies kann die Fähigkeit der Anlage beeinträchtigen, bestimmte Systemdienstleistungen zu erbringen, die auf der AC-Seite gemessen werden, etwa die Frequenzregelung.
- Die Kopplung hinter dem Wechselrichter integriert Solar- und Speicheranlagen noch stärker, was die Möglichkeit einer kommerziellen Trennung einschränkt und bestimmte Finanzierungswege, wie sie bei AC-Kopplung möglich sind, limitiert.
Psst... Wir freuen uns auf Ihr Feedback! 🙏
Ab sofort können Sie Kommentare zu Phase-Artikeln hinterlassen. Haben Sie eine Frage oder möchten Sie Ihre Meinung teilen? Lassen Sie es uns wissen! Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.