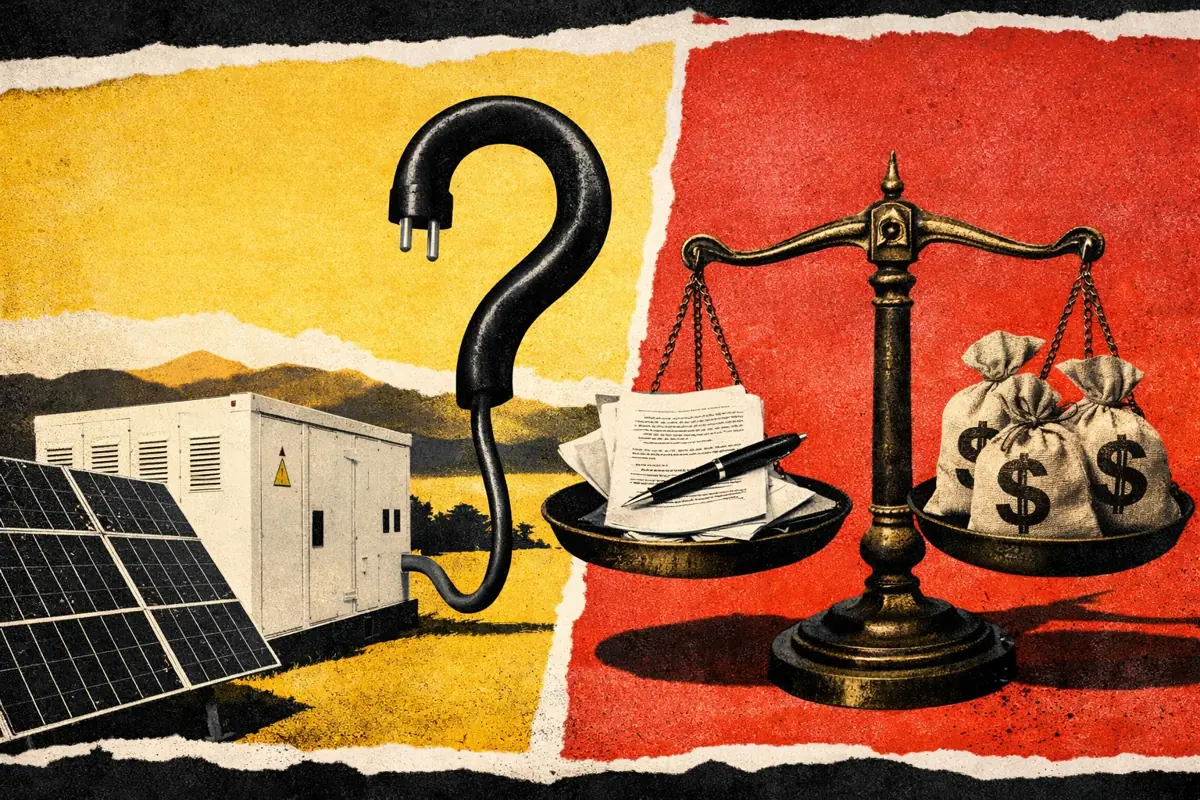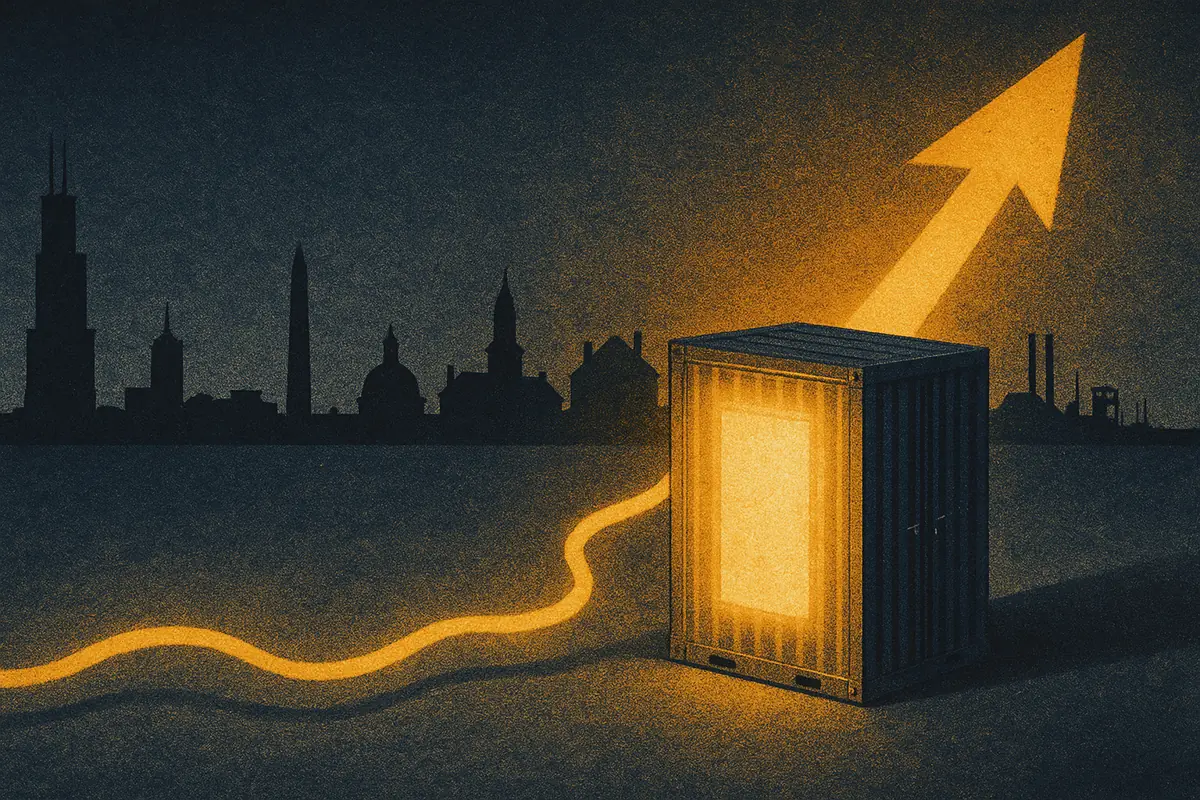Frequenzregelung: Wie verändern sich die Anforderungen an das Batterierecycling?
Frequenzregelung: Wie verändern sich die Anforderungen an das Batterierecycling?
Mit dem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien im Netz wird die Netzfrequenz volatiler. Eine Möglichkeit, dies zu steuern, sind Frequenzregelungsdienste – die in der Regel von Batteriespeichersystemen erbracht werden. Doch wie wirken sich veränderte Frequenzmuster auf die Batterien aus, die zur Netzstabilisierung beitragen?
Frequenzregelungsdienste
Die Netzfrequenz spiegelt das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch wider. Sind beide exakt ausgeglichen, liegt die Systemfrequenz bei 50 Hz.
Da Erzeugung und Verbrauch praktisch nie perfekt ausgeglichen sind, weicht die Frequenz meist von 50 Hz ab. Übersteigt die Erzeugung den Verbrauch, steigt die Frequenz – und umgekehrt.
National Grid ESO strebt an, die Frequenz zwischen 49,8 und 50,2 Hz zu halten – das sind die „operativen Grenzwerte“. (Es gibt zudem eine gesetzliche Vorgabe, dass die Frequenz zwischen 49,5 und 50,5 Hz liegen muss.)
- Um dies zu gewährleisten, nutzt National Grid ESO Netzdienstleistungen. In diesem Artikel liegt der Fokus auf Frequenzregelungsdiensten – die meist von Batteriespeichern erbracht werden.
- Liegt die Frequenz weniger als 0,015 Hz von 50 Hz entfernt, ist keine Maßnahme erforderlich – sie befindet sich innerhalb der sogenannten „Totzone“.
- Frequenzregelungsdienste greifen ein, wenn die Frequenz mehr als 0,015 Hz von 50 Hz abweicht – also außerhalb der „Totzone“.
Frequenz wird volatiler
Im Jahr 2023 verbringt die Frequenz weniger Zeit in der Totzone und entfernt sich häufiger weiter von 50 Hz. Das bedeutet: Die Frequenz ist volatiler geworden – und es wird mehr Regelenergie benötigt.

Hauptgrund dafür ist der gestiegene Anteil erneuerbarer Energien im Netz.
- Mehr erneuerbare Energien haben die Netzträgheit verringert (mehr dazu hier), sodass sich die Frequenz bei Ungleichgewichten schneller verändert.
- Zudem sorgen Windböen und vorbeiziehende Wolken für zusätzliche kurzfristige Schwankungen in der Erzeugung und damit der Frequenz.
In den letzten Jahren ist die Frequenzabweichung gestiegen – also die durchschnittliche Entfernung der Frequenz von 50 Hz. Im Schnitt liegt die Frequenz weiter von 50 Hz entfernt als je zuvor – in beide Richtungen.

Was bedeutet das für Batteriespeicher, die Frequenzregelung bereitstellen?
Zyklenraten durch Frequenzregelung steigen
Mit der zunehmenden Frequenzvariabilität steigt auch der Energieumsatz, der zur Bereitstellung von Frequenzregelung nötig ist. Das bedeutet: Batterien müssen häufiger be- und entladen werden, um die Dienstleistung zu erbringen.

Im Jahr 2023 sind die Anforderungen an den Energieumsatz für Frequenzregelungsdienste im Schnitt um mehr als 3 % gestiegen.

Der Energieumsatz bezieht sich hier auf die Anzahl der Zyklen, die zur Erbringung eines Dienstes notwendig sind – für eine einstündige Batterie bei 100 % verfügbarer Leistung.
Aber... diese Zyklenraten schwanken stark
Die Frequenz ist nicht immer vorhersehbar. An manchen Tagen ist sie volatiler oder bewegt sich deutlich in eine Richtung. Das kann erhebliche Auswirkungen auf die Anforderungen an die Zyklenrate bei Frequenzregelungsdiensten haben.

- Dynamic Regulation zeigt die größte absolute Schwankung bei den Zyklenraten – Dynamic Moderation weist prozentual die stärkste Variation auf.
- Ursache ist die erhöhte Leistung, sobald die Frequenz mehr als 0,1 Hz von 50 Hz abweicht.
- An Tagen, an denen die Frequenz besonders weit von 50 Hz abweicht, benötigt Dynamic Moderation fast das Dreifache an Energieumsatz – und damit an Zyklen – im Vergleich zum Normalbetrieb.
Die täglichen Zyklenraten werden von der Frequenzvarianz im Tagesverlauf bestimmt. Je weiter sich die Frequenz von 50 Hz entfernt, desto häufiger müssen Batterien im Rahmen der Frequenzregelung be- und entladen werden.

Generell gilt: Die Zyklenraten bei Hoch- und Niedrigfrequenzdiensten verhalten sich umgekehrt proportional. Die Tage mit den meisten Zyklen in die eine Richtung sind oft die mit den wenigsten in die andere. Das hat große Auswirkungen auf das Ladezustandsmanagement.
Praxisbeispiel Frequenzregelung: 1. April 2023
Am 1. April 2023 lag die Frequenz den Großteil des Tages unter 50 Hz. Der Tagesdurchschnitt betrug 49,96 Hz – der niedrigste Wert seit vor 2020! Trotzdem blieb die Frequenz meist innerhalb der operativen Bandbreite von 0,2 Hz.

Diese niedrige Frequenz hatte deutliche Auswirkungen auf Anbieter von Frequenzregelung.

- Dynamic Containment war kaum betroffen (aufgrund des geringeren Energiebedarfs).
- Für Dynamic Moderation wären jedoch mehr als ein kompletter Lade- und Entladezyklus nötig gewesen (bei einer einstündigen Batterie mit 100 % verfügbarer Leistung).
- Firm Frequency Response hätte fast zwei vollständige Zyklen erfordert.
- Und Dynamic Regulation? 4,8 Entladezyklen bei nur einem Ladezyklus.
Wie hat sich das auf Dynamic Regulation-Anbieter ausgewirkt?
Am 1. April führte die Diskrepanz zwischen dem Energiebedarf der Hoch- und Niedrigfrequenz-Dienste dazu, dass Betreiber zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen verstärkt am Großhandelsmarkt aktiv werden mussten, um den Ladezustand zu sichern.
Das schlug sich erheblich auf die Einnahmen der Dynamic Regulation-Anbieter nieder. In manchen Fällen wurden die Einnahmen durch die Kosten für das Ladezustandsmanagement (durch Zukauf am Großhandelsmarkt) komplett aufgezehrt.

Kemsley, eine 50-MW-Batterie, hat am 1. April im Schnitt 56 % seiner Leistung in die Niedrigfrequenz-Dynamic Regulation eingebracht. Um die Verpflichtungen zu erfüllen, musste das Asset mehrfach am Großhandelsmarkt nachladen.

Was haben wir herausgefunden?
- Die Anforderungen an die Zyklenrate für Frequenzregelungsdienste steigen im Schnitt weiter an. Mit mehr erneuerbaren Energien und geringerer Trägheit dürfte sich dieser Trend fortsetzen.
- Auch die Schwankungen bei der Anzahl der nötigen Zyklen nehmen zu. Das Management dieser Volatilität kann teuer werden und geplante Abläufe stark stören.
- Die Volatilität der Zyklenanforderungen bei Dynamic Regulation kann dazu führen, dass an bestimmten Tagen die Zyklenbegrenzungen eines Assets überschritten werden – sofern kein entsprechendes Management erfolgt.