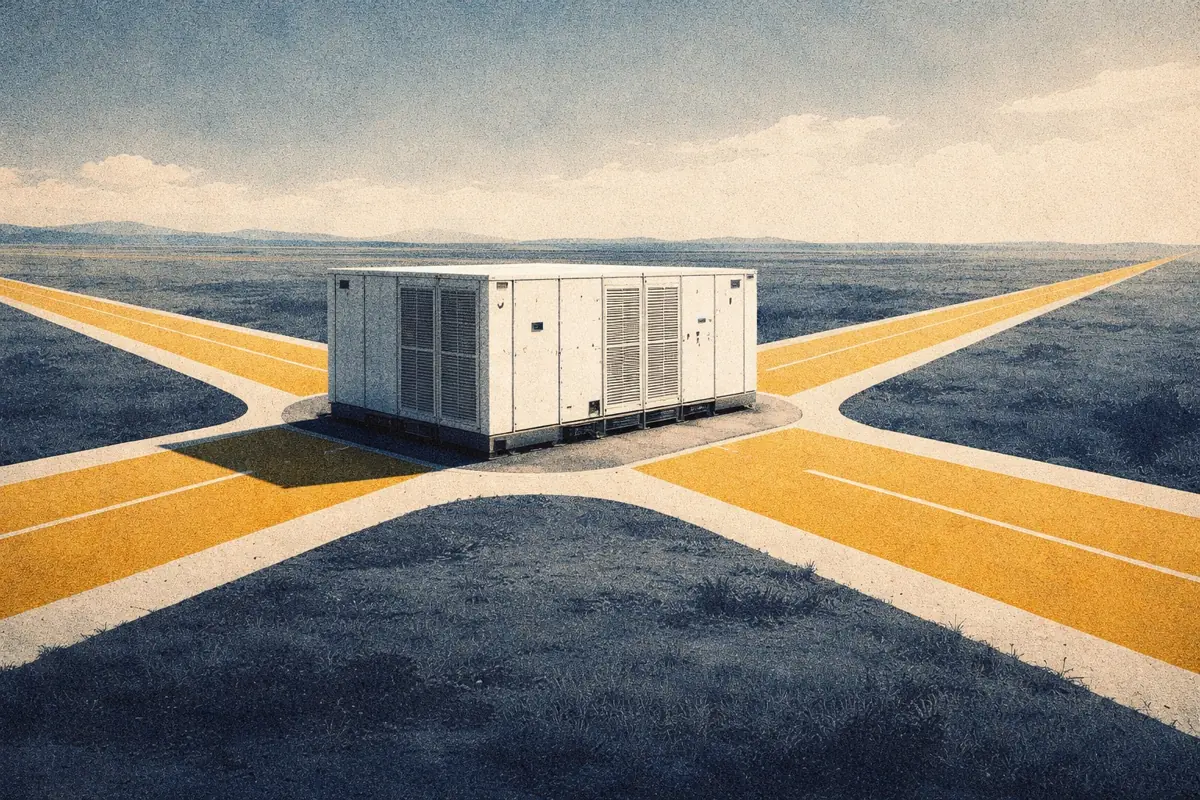Der CO₂-Vorteil von Batteriespeichern in Großbritannien
Bisher sind im Jahr 2023 die CO₂-Emissionen des britischen Stromsektors auf ein historisches Tief gesunken. Im April wurde sogar ein neuer Rekordwert für die halbstündliche CO₂-Intensität erreicht: nur 33 gCO2/kWh.
Doch wie groß ist der Beitrag von Batteriespeichern zur Reduzierung der CO₂-Emissionen?
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?

Batteriespeicher haben die Emissionen des britischen Stromsektors seit 2021 um über 1 % gesenkt

Fast der gesamte Nutzen stammt aus der Frequenzregelung

Dynamic Containment ist derzeit die CO₂-effizienteste Anwendung von Batteriespeichern

Die Methodik
Wie messen wir die CO₂-Emissionen des Stromsektors?
Die CO₂-Intensität misst den Ausstoß von Kohlendioxid bei der Stromerzeugung. Sie wird in gCO2/kWh angegeben. Im Grunde genommen: Wie viel CO₂ entsteht pro erzeugter Kilowattstunde Strom?
Die CO₂-Intensität einer bestimmten Technologie hängt von mehreren Faktoren ab – z. B. vom eingesetzten Brennstoff und vom Wirkungsgrad.

National Grid ESO berechnet und veröffentlicht die halbstündliche CO₂-Intensität des Netzes – die Daten finden Sie hier.
Wie können Batteriespeicher CO₂-Emissionen senken?
Batteriespeicher können die CO₂-Emissionen im Stromnetz auf zwei Arten reduzieren:
- Direkte Emissionsänderungen – durch den Import oder Export von Energie ins bzw. aus dem Netz.
- Indirekte Effekte – durch die Bereitstellung von Netzdienstleistungen (wie Frequenzregelung).
Doch wie lassen sich diese Effekte quantifizieren?
CO₂-Effekt direkter Energieaktionen
Immer wenn Batterien Strom importieren oder exportieren, verändert sich die Netto-Last im System. Das hat Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz.
Großbatterien im Netz importieren oder exportieren meist aus einem von drei Gründen:
- Energiearbitrage als Reaktion auf Preissignale.
- Maßnahmen im Rahmen des Balancing Mechanism auf Anweisung von National Grid ESO.
- Netzdienstleistungen – z. B. Entladung nach einem Frequenzabfall.
Indem man die importierten und exportierten Energiemengen mit der jeweiligen CO₂-Intensität multipliziert, lässt sich die CO₂-Wirkung berechnen.

- Seit Einführung von Dynamic Regulation haben die Energieaktionen von Batterien tatsächlich zu 8.000 Tonnen zusätzlichen Emissionen geführt.
- Insgesamt ist dieser Wert jedoch vernachlässigbar – der Stromsektor war im gleichen Zeitraum für 123 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich!
Im Wesentlichen senken die Energieaktionen von Batteriespeichern nicht die CO₂-Intensität des Netzes. Wie also senken Batterien die Emissionen?
CO₂-Effekt von Netzdienstleistungen
Batterien sind meist für verschiedene Frequenzregelungsdienste im Einsatz. Es gibt vier Hauptdienste, die Batterien bereitstellen:
- Dynamic Containment – sehr schnelle, nach einem Fehler aktivierte Dienstleistung.
- Dynamic Moderation – sehr schnelle, vor einem Fehler aktivierte Dienstleistung.
- Dynamic Regulation – schnelle, vor einem Fehler aktivierte Dienstleistung.
- Firm Frequency Response – langsamere Dienstleistung, vor und nach einem Fehler.
Diese Dienste führen dazu, dass Batterien laden und entladen (wie oben beschrieben). Ihr Hauptvorteil besteht jedoch darin, dass National Grid ESO das System sicher und stabil betreiben kann – und dabei Emissionen reduziert werden.
Doch wie groß ist der CO₂-Vorteil durch diese Netzdienstleistungen? Das lässt sich abschätzen, indem man betrachtet, welche Maßnahmen ohne Batteriespeicher nötig gewesen wären.
Mandatory Frequency Response
Das Stromsystem benötigt Frequenzregelung, um die Netzfrequenz stabil zu halten. Kann National Grid ESO nicht genug Leistung aus den vier oben genannten Diensten beschaffen, greift die Leitstelle auf die Mandatory Frequency Response zurück.
CCGTs (Gas-und-Dampf-Kraftwerke) stellen den Großteil der Mandatory Frequency Response bereit. Daher lag die durchschnittliche CO₂-Intensität der Systeme, die diesen Dienst zwischen April 2022 und März 2023 lieferten, bei 391 gCO2/kWh.

Dieser Dienst ist langsamer als die drei neuen dynamischen Frequenzregelungsdienste – daher ist er weniger effizient, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das bedeutet, dass mehr Megawatt benötigt werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Zum Beispiel kann Dynamic Containment bei niedriger Frequenz bis zu dreimal so viel Volumen benötigen wie die Mandatory Frequency Response, um dieselbe Wirkung zu erzielen.

Vermeidene Emissionen durch MFR
Eigentlich sollten sich die CO₂-Effekte von Mandatory Frequency Response bei hoher und niedriger Frequenz ausgleichen. Bis vor Kurzem hat National Grid ESO jedoch die Reaktion auf niedrige Frequenz deutlich priorisiert – insbesondere beim Dynamic Containment.
Die Nutzung von Mandatory Frequency Response anstelle von Dynamic Containment bei niedriger Frequenz führt zu erhöhten Emissionen – daher sparen Batterien, die Dynamic Containment bereitstellen, CO₂ ein. Seit 2021 wurden dadurch rund 480.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden.

Verbesserte Systemeffizienz
Eine weitere Folge der Mandatory Frequency Response ist eine geringere Gesamteffizienz des Systems. Oft müssen Kraftwerke, die diesen Dienst erbringen, ihre Leistung reduzieren, um ausreichend Regelreserve bereitzustellen. CCGTs arbeiten am effizientesten bei Volllast – für die Bereitstellung von Mandatory Frequency Response werden sie aber häufig auf einen niedrigeren Wert eingestellt.

Um das System auszugleichen, muss ein anderes Kraftwerk seine Leistung erhöhen (häufig ein weniger effizientes CCGT). Das führt insgesamt zu einer geringeren Effizienz und damit zu höheren CO₂-Emissionen an beiden Standorten.
Dieser Effekt erscheint gering – nur etwa 0,5 % höhere CO₂-Intensität über beide Anlagen hinweg. Allerdings bezieht sich diese Steigerung auf die gesamte Stromproduktion beider Anlagen, nicht nur auf das Volumen der Mandatory Frequency Response. Das führt zu mehr Emissionen.

Das ist noch nicht alles. Manchmal führt die Mandatory Frequency Response sogar dazu, dass Windkraft abgeregelt werden muss. Die CO₂-Auswirkungen solcher Maßnahmen wären noch deutlich höher.
Im Durchschnitt führt eine MWh Mandatory Frequency Response zu einer 4 % höheren CO₂-Intensität der entsprechenden Strommenge.
Seit 2021 entspricht das 637.000 Tonnen vermiedener CO2-Emissionen.
Vermeidene Maßnahmen zum Inertiamanagement
Trägheit ist eine physikalische Eigenschaft von Stromsystemen, die die Geschwindigkeit von Frequenzänderungen verlangsamt. Sie wird überwiegend als Nebenprodukt großer, synchronisierter Generatoren bereitgestellt. National Grid ESO muss ein Mindestmaß an Trägheit im Netz sicherstellen, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
Fällt die marktbasierte Netzträgheit unter diesen Wert, muss die Leitstelle Windkraft oder Interkonnektoren abregeln (die keine Trägheit liefern) und CCGTs hochfahren – was die CO₂-Emissionen erhöht.
Das System verzeichnet inzwischen sowohl eine geringere durchschnittliche als auch eine geringere Mindest-Trägheit. Die Einführung von Dynamic Containment und das Accelerated Loss of Mains Change Programme haben das System auch bei geringerer Trägheit sicherer gemacht.
Zu beachten ist, dass die von National Grid ESO veröffentlichten Daten zur Systemträgheit nur Schätzungen sind und möglicherweise nicht der tatsächlichen Trägheit entsprechen.

Wie wirkt sich das auf die CO₂-Emissionen aus?
Wenn ESO Trägheit benötigt, greift sie im Balancing Mechanism meist auf CCGTs zurück. Windkraft wird häufig abgeregelt.

Dynamic Containment ermöglicht es, das System mit geringerer Trägheit zu betreiben. Dadurch ist ESO weniger auf CCGTs angewiesen, um Trägheitsverluste auszugleichen.

Dadurch konnten seit 2021 rund 174.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.
Unsicherheiten bei diesen Zahlen
Die Modellierung der vermiedenen Emissionen durch Batteriespeicher ist komplex – und erfordert bestimmte Annahmen.
Insgesamt sind die in diesem Artikel genannten Werte eher konservativ geschätzt.

Wie könnte der CO₂-Nutzen des Batteriespeicherbestands künftig steigen?
Über die oben genannten Vorteile hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, wie Batteriespeicher die CO₂-Emissionen senken können – diese werden in Zukunft vermutlich noch wichtiger.
- Reduzierung der Abregelung von Wind- und Solarenergie. Dieser Effekt ist aktuell noch gering, könnte aber mit neuen Speichern in Netzengpassregionen deutlich steigen. Mehr dazu hier.
- Ersetzen fossiler Reservekraftwerke. Reserveleistungen werden fast ausschließlich von Kraftwerken mit hoher CO₂-Intensität erbracht. Mit neuen Reserveprodukten könnten Batteriespeicher hier zunehmend fossile Kraftwerke verdrängen. Mehr zu Quick und Slow Reserve hier und zur Balancing Reserve hier.
- Kapazitätsmarkt – Verhindern des Baus neuer fossiler Kraftwerke. Mit 1,3 GW deklassierter Batteriespeicher, die im letzten T-4 eine Kapazitätsmarkt-Ausschreibung gewonnen haben (siehe hier), beginnt sich dieser Effekt abzuzeichnen.