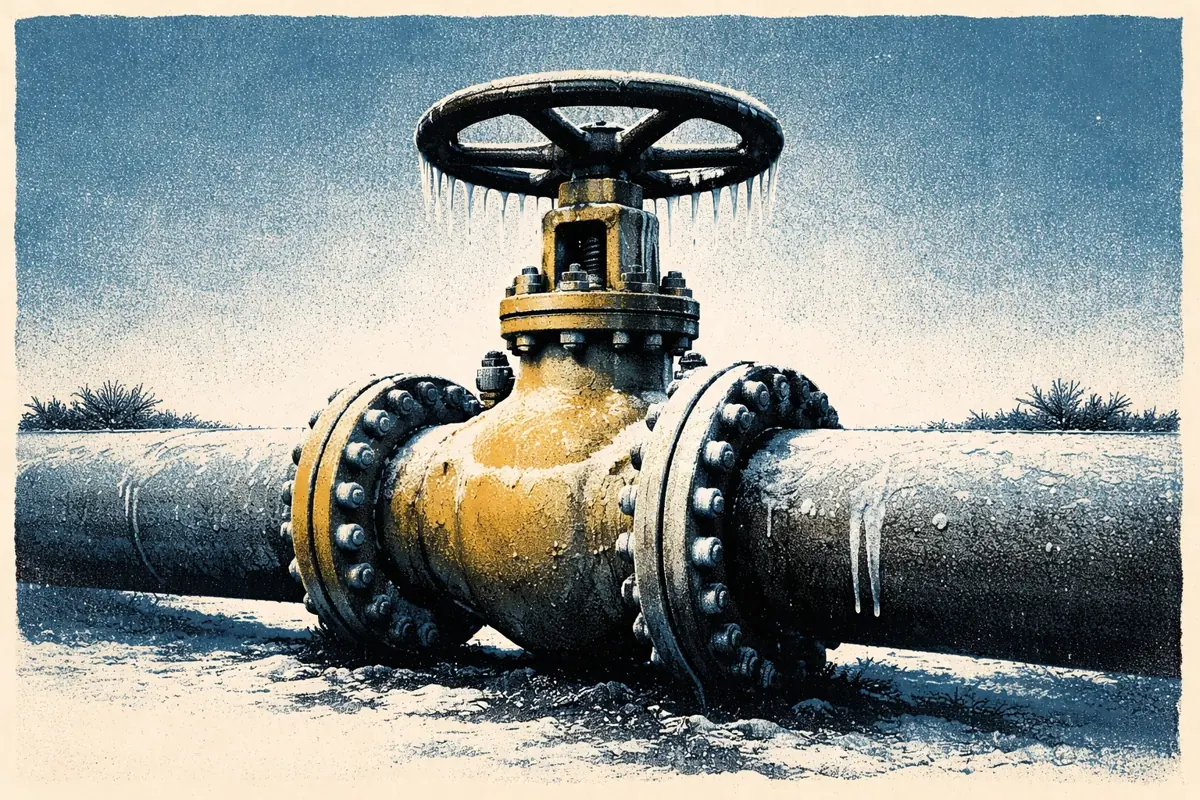Frankreichs Stromnetz im Wandel: Kann die Kernkraft mithalten?
Frankreichs Stromnetz im Wandel: Kann die Kernkraft mithalten?
Jahrelang galt die französische Kernenergie als stabile, unveränderte Quelle für Grundlaststrom.
Doch mit dem Ausbau der Erneuerbaren und stärkeren Preisschwankungen im Tagesverlauf ist die Flexibilität der Kernkraft zu einem festen Bestandteil des französischen Stromsystems geworden. Wie weit kann die Flotte noch mitgehen, bevor Alterung und Verschleiß die Grenzen setzen?
Bei Fragen zum Inhalt dieses Artikels wenden Sie sich gerne an den Autor timothee@modoenergy.com.
Wichtigste Erkenntnisse
- Frankreichs Kernkraftflotte hat sich bereits an Erneuerbare angepasst. Sie fährt nun täglich mit der Sonne hoch und runter – der mittlere Output schwankt 2025 um 6 GW, verglichen mit 1,5 GW im Jahr 2022.
- Diese Flexibilität hilft, beseitigt aber nicht die durch Solarenergie verursachte Volatilität. Negative Preise und Intraday-Spreads nehmen zu.
- Mit wachsender Solarleistung rücken stärkere Lastwechsel, Haltbarkeit und Kosten in den Fokus.
- Lebensdauerverlängerungen der Kernkraftwerke bestimmen das Gleichgewicht im Stromsystem. Ihr Ausgang definiert die Rolle von Speicherlösungen, solange neue Reaktoren noch Jahre entfernt sind.
1. Die tägliche Flexibilität der französischen Kernkraft ist zur Norm geworden
Im Jahr 2025 wurde Flexibilität bei der Kernkraft zur Normalität.
Kernkraft ist nicht mehr nur eine starre Grundlastquelle, sondern Teil des täglichen Ausgleichs im System. Mit steigendem Solaranteil drosseln Reaktoren mittags ihre Leistung und fahren sie abends wieder hoch.
Die täglichen Schwankungen der Kernkraftleistung sind deutlich gestiegen, im Durchschnitt 6 GW im Jahr 2025 gegenüber 1,5 GW im Jahr 2022.
Diese Flexibilität ist saisonal. Zwei Trends stechen hervor:
- Der Niveaueffekt verstärkt sich. Reaktoren laufen im Winter höher und im Sommer niedriger – diese saisonale Lücke hat sich in den letzten Jahren vergrößert.
- Der Formeffekt wird ausgeprägter. Kernkraft drosselt mittags tiefer, je mehr Solar hinzukommt, und erholt sich abends, besonders im Sommer. Im Winter bleibt das Profil flacher mit nur kleinen Mittagseinbrüchen.
Mit weiter wachsender Solarkapazität und steigenden Mittagsimporten werden die Anforderungen an das Hoch- und Runterfahren weiter steigen. Die Kernkraftflotte konnte dies bislang bewältigen. Doch stärkere tägliche Lastwechsel entfernen die Reaktoren immer weiter vom Dauerbetrieb. Das könnte sich zunehmend auf Wartungszyklen und technische Lebensdauer auswirken.
2. Kernkraft-Flexibilität wird durch Preise getrieben und konzentriert sich auf wenige Anlagen
Die Flexibilität der Kernkraft in Frankreich ist bewusst gesteuert. Als nationaler Monopolbetreiber steuert EDF die Flotte und kann die Leistung an Marktimpulse anpassen.
Die französische Energieregulierungsbehörde (CRE) schätzt die brennstoffbezogenen kurzfristigen Grenzkosten der Kernkraft auf 8 €/MWh.
In der Praxis wird zurückgefahren, wenn die Preise gegen Null tendieren oder darunter fallen. Das zeigt, dass EDFs Modulationsentscheidungen über die reinen Brennstoffkosten hinausgehen und Marktanreize mit betrieblichen Strategien und Zwängen verbinden.
Diese Flexibilität nimmt einen Teil des Solarüberschusses auf, beseitigt aber nicht die mittagsbedingten Preisschwankungen. Frankreich verzeichnete 2025 bislang 436 Stunden mit negativen Preisen – extreme Preistiefs werden häufiger, was Arbitrage für Speicher attraktiv hält.
Day-Ahead-Preise und Kernkraftproduktion verlaufen eng miteinander – bei fallenden Preisen wird die Erzeugung gesenkt. Am 10. August sank die Auslastung auf 41 %, als der Day-Ahead-Preis −50 €/MWh erreichte.
Diese Flexibilität verteilt sich jedoch nicht gleichmäßig auf die Flotte. EDF konzentriert die Modulation auf eine Gruppe von Reaktoren und passt dort an, wo es am günstigsten ist.
Das Kraftwerk Cruas verdeutlicht diesen Spielraum: Am 10. August, als der Markt stark überversorgt war und die Preise auf -50 €/MWh fielen, reduzierte das sonst konstante Cruas seine Leistung – ein Beweis für EDFs Fähigkeit, die Flotte flexibel zu steuern.
Warum sind manche Reaktoren flexibler als andere?
Die Flexibilität der Reaktoren ist das Ergebnis mehrerer Faktoren:
- Kernkraftwerke bestehen meist aus mehreren Blöcken. Betreiber verteilen die Flexibilität, indem sie einen Block stärker regeln, während andere konstant laufen.
- Gegen Ende des Brennstoffzyklus sinkt der Reaktivitäts-Spielraum, daher reduzieren Betreiber in dieser Phase Tiefe und Häufigkeit der Lastwechsel – wie von der Nuclear Energy Agency beschrieben.
- Die Netzlage und die Redispatch-Rolle: Die geografische Position eines Reaktors bestimmt, wie oft er unabhängig vom Preis zur Anpassung herangezogen wird.
- Anlagenspezifische Betriebs- und Wartungsbedingungen können die Flexibilität begrenzen. Zum Beispiel führten die Spannungsrissbefunde 2022 zu einer vorsorglichen Einschränkung des Lastwechsel-Fensters betroffener Anlagen.
Die ungleichmäßige Verteilung der Flexibilität zeigt, dass EDF noch Spielraum hat, auch weniger flexible Blöcke stärker zu modulieren. Dies führt jedoch zu dauerhaft mehr Lastwechseln, was Verschleiß und Kosten erhöht und damit die tatsächlichen Stromgestehungskosten (LCOE) der Kernkraft steigen lässt.
Auch die Haltbarkeit rückt in den Fokus: Studien zeigen, dass häufigere und tiefere Lastwechsel die alternden Anlagen stärker belasten und die Frage in den Vordergrund rücken, wie lange die Flotte noch betrieben werden kann.
3. Frankreichs Kernkraftflotte steuert auf eine Kapazitätsklippe zu
Die französische Flotte entstand rasch in den Jahren nach der Ölkrise – 56 Reaktoren gingen innerhalb von zwei Jahrzehnten ans Netz. Das Ergebnis war ein günstiges, CO₂-armes Stromsystem, das 1990 78 % der Stromerzeugung stellte und auch 2024 noch 65 % ausmacht.
Weil der Ausbau in kurzer Zeit erfolgte, altern viele Reaktoren parallel. Dadurch droht eine Kapazitätsklippe, wenn sie in den Ruhestand gehen.
Frankreichs aktueller Fahrplan setzt darauf, die bestehenden Reaktoren länger laufen zu lassen. Verlängerungen auf fünfzig Jahre – und wo möglich sogar über sechzig hinaus – sind entscheidend, um die Kapazität zu halten, solange neue Reaktoren noch Jahre entfernt sind.
Jede zehnjährige Verlängerung unterliegt einer strengen, unabhängigen Prüfung durch die Nuklearsicherheitsbehörde (ASN). Häufigere und tiefere Lastwechsel erhöhen den mechanischen Verschleiß, was sich auf diese Prüfungen auswirken und letztlich die Lebensdauerverlängerungen gefährden kann.
Vor diesem Hintergrund hängen die Kapazitätsaussichten von zwei Faktoren ab: Wie weit sind sichere Verlängerungen bei der bestehenden Flotte möglich, und wie schnell und groß wird das EPR2-Programm (die nächste Generation europäischer Druckwasserreaktoren) der Regierung umgesetzt?
Ausblick
Frankreichs Strommix steht an einem Wendepunkt. Während Lebensdauerverlängerungen voranschreiten und neue Reaktoren noch auf sich warten lassen, wird das Gleichgewicht zwischen nuklearer Stabilität und Erneuerbaren das kommende Jahrzehnt prägen.
Bleibt die Flotte stabil, sorgt die Kernkraft für stabile Preise und Batterien konzentrieren sich auf Reserve und Netzoptimierung. Verkürzt sich die Lebensdauer durch Alterung und tiefere Flexibilität, werden Speicherlösungen unverzichtbar, um die Lücke zu schließen und die Stromversorgung bei zunehmender Elektrifizierung abzusichern.