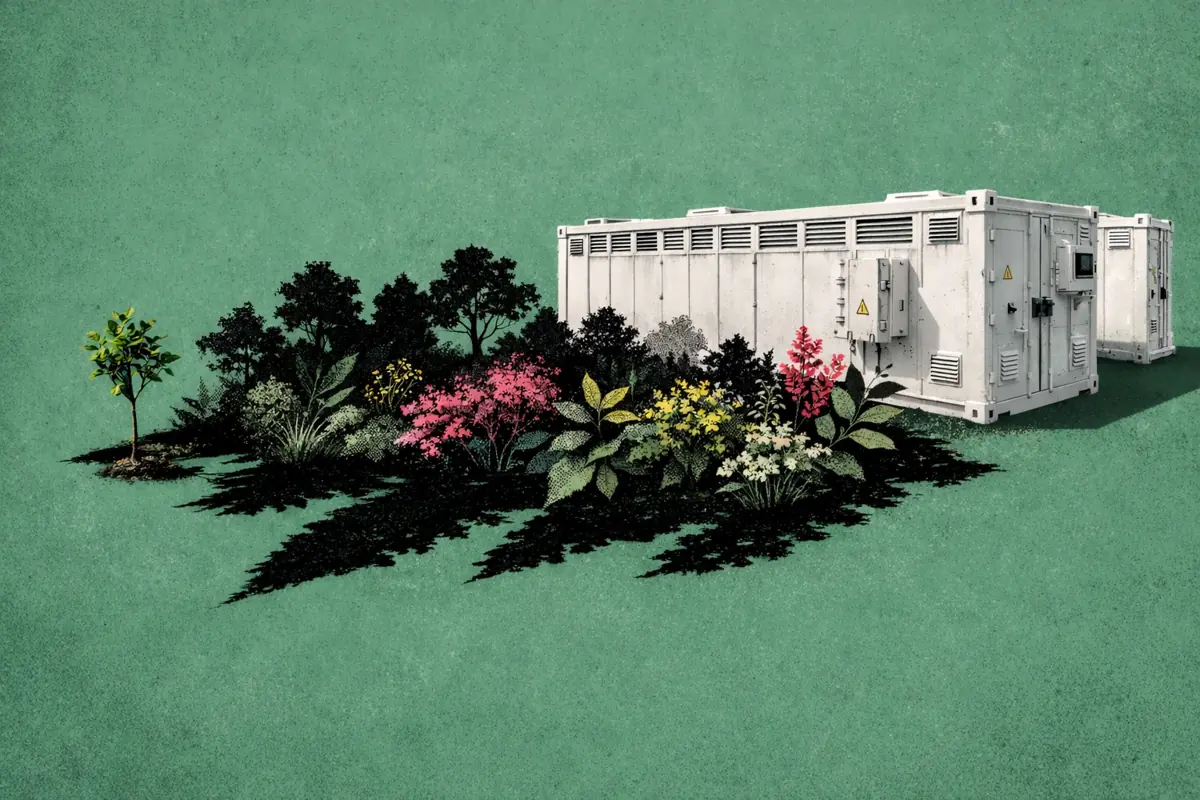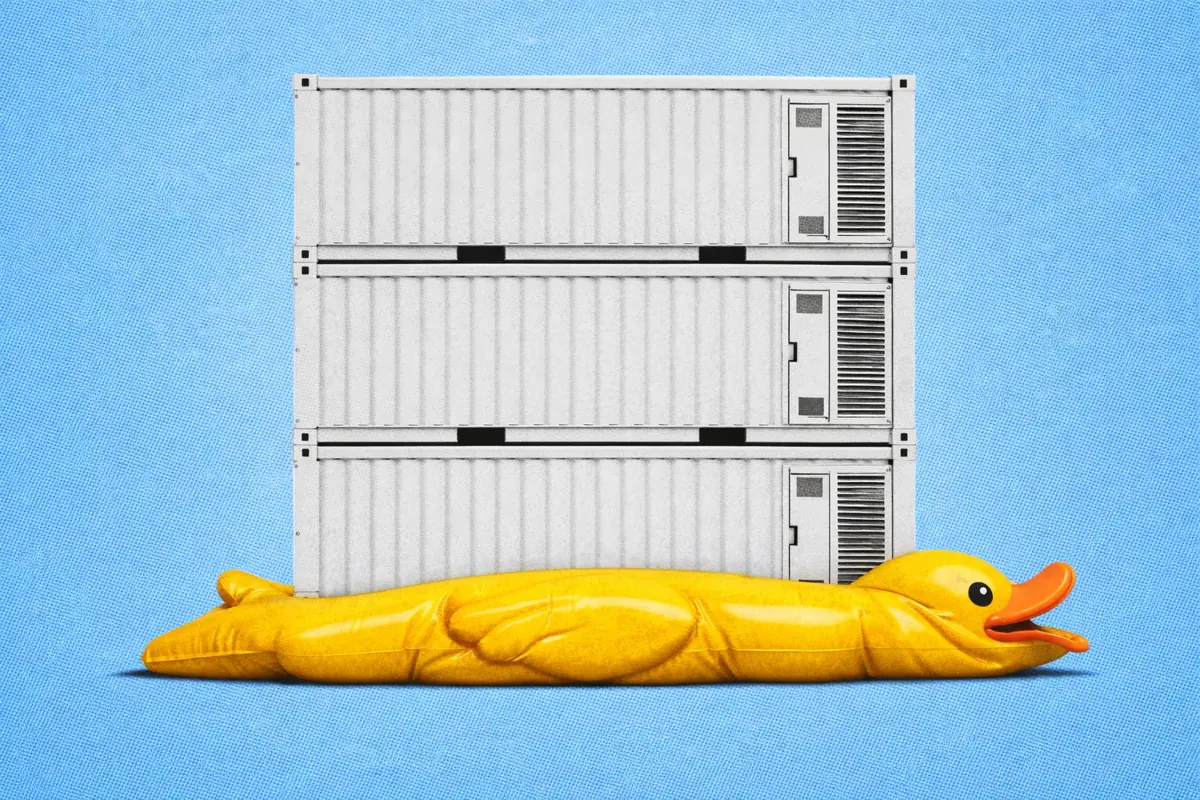Nelson-Review: Wie das ESEM und andere NEM-Reformen BESS beeinflussen
Nelson-Review: Wie das ESEM und andere NEM-Reformen BESS beeinflussen
Das australische Stromsystem befindet sich im Wandel: Weg von einer preisbildenden Struktur, die auf fossilen Brennstoffen basiert, hin zu einer Welt, die von erneuerbaren Energien, Speichertechnologien und flexibler Nachfrage dominiert wird. Der erste Entwurf der Nelson-Review kommt zu dem Schluss, dass der NEM sein Energie-Only-Kernmodell beibehalten sollte, die Regeln jedoch angepasst werden müssen, um eine effiziente Preisbildung bei zunehmender Volatilität und Variabilität zu gewährleisten. Zudem empfiehlt der Bericht die Einführung eines langfristigen Investitions-Backstops über den Electricity Services Entry Mechanism (ESEM).
Die im Bericht veröffentlichten Empfehlungen konzentrieren sich auf drei Zeithorizonte: den kurzfristigen Spotmarkt, den mittelfristigen Terminmarkt sowie langfristige Anreize für neue Kapazitäten.
In diesem Artikel fassen wir die wichtigsten Empfehlungen zusammen und beleuchten die Auswirkungen auf BESS.
Zusammenfassung
- Die Nelson-Review hält am Energie-Only-Modell des NEM fest, empfiehlt jedoch gezielte Reformen über kurz-, mittel- und langfristige Markthorizonte hinweg.
- Kurzfristige Reformen konzentrieren sich auf eine bessere Überwachung von Autobidding und Re-Bidding, Transparenz bei kundeneigenen Energieressourcen (CER) sowie Anreize für Netzbetreiber (TNSPs), um ausfallbedingte Volatilität zu reduzieren.
- Mittelfristige Reformen setzen auf stärkere Terminmärkte, die sich um drei standardisierte Vertragstypen gruppieren: Bulk Clean Energy, Shaping und Firming. Diese sollen die Liquidität erhöhen und die Grundlage für das ESEM bilden.
- Der Electricity Services Entry Mechanism (ESEM) adressiert die „Tenor-Lücke“, indem er Verträge für spätere Projektjahre absichert und so die Kapitalkosten für neue saubere Energie- und Firming-Projekte senkt.
- Für BESS bedeutet die Review mehr operative Transparenz, tiefere Beteiligung an Derivateprodukten und potenziell günstigere Finanzierung durch langfristige ESEM-Verträge.
Zusammenfassung: Was ist die Nelson-Review?
Die Nelson-Review, offiziell die NEM Wholesale Market Settings Review, ist eine unabhängige Untersuchung darüber, wie sich Australiens Großhandelsstrommarkt weiterentwickeln muss, wenn Kohle aussteigt und erneuerbare Energien sowie Speicher ausgebaut werden. Das Kernergebnis lautet, dass der aktuelle energie-Only-Spotmarkt die Basis bleiben sollte, die unterstützenden Rahmenbedingungen jedoch reformiert werden müssen, damit Investitionen und Versorgungssicherheit ohne übermäßige Kosten für Verbraucher erhalten bleiben.
Die Review versucht, die „Tenor-Lücke“ bei der Finanzierung zu lösen. Projektentwickler benötigen oft 10–30 Jahre Einnahmensicherheit, um Kapital zu beschaffen, während Abnehmer (z. B. Off-Taker) zunehmend nicht länger als 7 Jahre Verträge abschließen möchten. Diese Diskrepanz führt dazu, dass spätere Erlöse einem höheren Marktrisiko ausgesetzt sind, was die Kosten erhöht und Projekte bremst, die sonst wirtschaftlich wären.
Die Review schlägt den Electricity Services Entry Mechanism (ESEM) als langfristigen Vertrags-Backstop vor. Damit kann der Markt kurzfristige Risiken bepreisen, während eine staatlich unterstützte „Warehouse“-Struktur standardisierte, handelbare Verträge für Jahre 8–15 und darüber hinaus absichert.
Durch die Schließung der Tenor-Lücke soll das Review die Kapitalkosten für neue Null-Emissions- und Firming-Projekte – insbesondere Batterien – senken, während gleichzeitig die Preissignale im Spotmarkt erhalten bleiben.
Kurzfristige Markteinstellungen: Spotmarkt beibehalten, aber bestimmte Probleme adressieren
Das Panel empfiehlt, den regionalen Energie-Only-Spotmarkt in Echtzeit beizubehalten. Das bedeutet: Kein Kapazitätsmarkt, keine lokationsbezogene Marginalpreisbildung und keine physische Vorausplanung (z. B. Day-Ahead). Stattdessen schlägt die Review gezielte Regeländerungen vor, um die Effizienz im Dispatch zu sichern, während sich das Bietverhalten und die Netzbedingungen weiterentwickeln.
Vier kurzfristige Prioritäten sind für Speicher besonders relevant:
- Überwachung von Re-Bidding & algorithmischem Bieten. Der Bericht thematisiert die Sorge um „übermäßiges“ Re-Bidding und algorithmische Kollusion. Es wird vorgeschlagen, dass Marktakteure das Ausmaß analysieren und Governance-Standards setzen. AER-Analysen zu Extrempreisen bringen Re-Bidding mit vielen dieser Ereignisse in Verbindung, aber eine klare Definition von „übermäßig“ ist schwierig.
- Transparenz beim Ladezustand. Seit dem 1. Juli 2025 veröffentlicht AEMO Echtzeitdaten zum Ladezustand von Batterien. Der Bericht fordert Marktakteure auf, zu prüfen, ob dies Zuverlässigkeitsrisiken bei assets mit begrenzter Dauer ausreichend mindert. Die jüngste Volatilität im Juni und Juli zeigt, wie dies zu unnötig hohen Preisspitzen führen kann.
- Auswirkungen von Netzabschaltungen. Ausfälle und Engpässe schaffen häufig die Voraussetzungen für Preisspitzen – 73 % der Stunden mit Extrempreisen 2024 und 2025 traten während Netzengpässen auf. Die Nelson-Review befürwortet stärkere Anreize für Netzbetreiber, die Volatilität im Großhandelsmarkt zu minimieren, und schlägt vor, dass die AER Marktmacht während Ausfällen begrenzt.
- Preisreaktive Ressourcen sichtbar machen. Bis 2030 sollten aggregierte Kleinspeicher, VPPs und große flexible Verbraucher entweder am Dispatch teilnehmen oder im Markt sichtbar sein. Das würde die Preisbildung und Prognostizierbarkeit verbessern, ohne jedem Asset vollständige Fahrplanpflichten aufzuerlegen.
Bedeutung für Batterien aktuell: Die Überprüfung von Autobidding dürfte zunehmen, die Transparenz beim Ladezustand ist bereits eingeführt, könnte sich aber weiterentwickeln, und die Preisvolatilität könnte abnehmen, wenn Netzbetreiber richtig incentiviert werden und die CER-Marktteilnahme steigt.
Mittelfristige Markteinstellungen: Sichtbarkeit, Liquidität und Zukunftssicherheit
Im mittelfristigen Fokus steht der Terminmarkt und seine Ausrichtung auf die Systembedürfnisse sowie das ESEM. Die Ausgestaltung neuer Verträge wird von der Branche bestimmt und durch die AER begleitet.
Die Nelson-Review betont, dass Terminmärkte tiefere und länger laufende Absicherungen benötigen, damit Energieversorger Volatilität steuern und Entwickler kapitalintensive Anlagen finanzieren können. Dafür soll der Markt auf drei standardisierte Produkttypen konvergieren:
- Bulk Clean Energy Contracts (im Wesentlichen feste, emissionsfreie Lieferblöcke, vermutlich über Renewable Energy Guarantee of Origin (REGO)-Zertifikate).
- Shaping Contracts (z. B. virtuelle Tolls mit Nominierung oder einfacherer Swap auf Basis Top-Bottom-(TB)-Spread).
- Firming Contracts (heutige Cap-Contracts dürften weiterhin die beste Option sein).
Diese standardisierten Produkte sind entscheidend, weil sie die Grundlage für das tägliche Risikomanagement und die langfristigen ESEM-Auktionen bilden. Ziel ist, eine konsistente Brücke über alle Zeithorizonte hinweg zu schaffen.
Auswirkungen auf BESS: VPPs und Großbatterien werden künftig stärker gefordert, aktiv am Terminmarkt teilzunehmen und Shaping- sowie Firming-Produkte zu verkaufen. Standardisierung soll Transaktionskosten senken, Liquidität verbessern und BESS-Portfolios auf die langlaufenden ESEM-Auktionen ausrichten. Das könnte die Markteintrittsbarrieren für kleinere Portfolio-Eigentümer senken.
Langfristige Markteinstellungen: Der ESEM-Backstop
Das Herzstück der Nelson-Review ist der Electricity Services Entry Mechanism (ESEM). Dieser würde als permanenter Mechanismus im National Electricity Law (NEL) verankert und ersetzt das Capacity Investment Scheme (CIS). Er kontrahiert nur die späten Projektjahre, die Anfangsjahre verbleiben im Markt. Ziel ist, die „Tenor-Lücke“ zwischen der 3- bis 7-jährigen Nachfrage der Käufer und dem 10–30-jährigen Finanzierungsbedarf der Verkäufer zu schließen, indem standardisierte Finanzderivate zur Absicherung der späteren Jahre eingesetzt werden.
So würde es funktionieren:
- Anfangs Beschaffung von Bulk-Zero-Emissions-Energie, Shaping und Firming über langfristige Verträge, ermittelt durch wettbewerbliche Auktionen. Die Hauptdienstleistung, die Batterien bieten können, ist Shaping; längere Speicher können auch Firming übernehmen.
- Auktionsziele richten sich nach den langfristigen Zuverlässigkeits- und Erneuerbaren-Zielen der Bundesstaaten, die gemeinsam das nationale Stromziel bilden.
- Verträge sind fungible, standardisierte Derivate, die gemeinsam mit der Branche entwickelt werden (in Anlehnung an die Empfehlungen für den mittelfristigen Terminmarkt), sodass sie handelbar sind und vor Ablauf wieder in den Markt zurückgeführt werden können – das minimiert Kosten und erhöht die Liquidität.
- Entwickler verkaufen zuerst kurzfristige Erzeugung am Markt. Für spätere Erlöse bieten sie in ESEM-Auktionen mit einem Preis, der ihre langfristigen Spreads/Kosten widerspiegelt; günstigere Portfolios gewinnen. Diese Verträge werden von einer öffentlichen Stelle „geparkt“ und schrittweise wieder an den Markt abgegeben.
- ESEM-Tender könnten Projekte bevorzugen, die Netzunterstützungsfähigkeiten bündeln (z. B. grid-forming Modi), sofern dies kosteneffizient ist und mit AEMO/Netzbetreibern koordiniert wird. Die Review schlägt jedoch nicht vor, diese Dienste über den Markt zu beschaffen.
Was könnte das ESEM für BESS bedeuten?
Der „hybride“ Ansatz des ESEM soll die scharfen Preissignale des Spotmarkts erhalten und nur die Risiken absichern, die der Markt nicht tragen kann. Gleichzeitig soll die Liquidität der Derivate durch Standardisierung und Recycling der Verträge erhöht werden. Die Einführung könnte verschiedene Auswirkungen auf Batteriespeicher haben.
- Weiterer Ausbau. 12,5 GW Batteriespeicher sind im NEM bereits in Betrieb, im Bau oder haben FID erreicht. Der ISP sieht bis 2035 einen Bedarf von 26 GW. Die erfolgreiche Umsetzung des ESEM sollte dies ermöglichen, würde aber zugleich den Druck auf die Preisspreads im Spotmarkt erhöhen.
- Ende des CIS und einfacherer Zugang zu Finanzierung. 2,3 GW BESS haben bisher CIS-Verträge gewonnen, aber noch keines hat FID erreicht. Eine Herausforderung beim CIS war die Maßanfertigung der Verträge. Das ESEM soll Standardisierung bringen und so die Finanzierung erleichtern.
- Beschleunigung virtueller Off-Take-Verträge. Langfristige Off-Take-Verträge sind ein zentrales Element bei Batteriespeichern im NEM. Durch die Integration in die langfristige Geschäftsgrundlage von BESS zwingt das ESEM Entwickler, diesen Markt zu verstehen. Ebenso dürfte die Umstellung auf virtuelle Off-Takes und weg von physischen Tolls gefestigt werden.
- Mehr kurzfristige Marktexponierung. Da das ESEM erst ab einem bestimmten Projektjahr greift, sind gewinnende Projekte kurzfristig stärker der Marktvolatilität ausgesetzt als beim CIS. Mit weiter steigendem BESS-Ausbau wächst das Risiko kurzfristig sinkender Preisspreads.
- Bessere Preistransparenz. Das CIS bietet bislang keine Transparenz über Gewinnpreise, die Review empfiehlt jedoch, die Clearingpreise erfolgreicher ESEM-Auktionen zu veröffentlichen. Das sollte die Langfristbewertung von BESS verbessern.
Offene Fragen
- Definition der Derivateprodukte. Die genaue Ausgestaltung der standardisierten ESEM-Verträge (z. B. vierstündige Firming-Blöcke vs. Cap-ähnliche Strukturen) wird gemeinsam mit der Branche entwickelt und dürfte die Gewinner nach Technologie und Portfolio beeinflussen.
- NEO-ausgerichtete Volumina. Auktionsvolumina werden durch das National Electricity Objective (NEO) und Zuverlässigkeitsanforderungen bestimmt. Die Nelson-Review hebt dieses Prinzip hervor, bleibt aber vage. Die Marktauswirkungen des ESEM hängen davon ab, wie sich diese Volumina künftig auf die Auktionen auswirken.
- Systemdienstleistungen. (also Netzstützungsdienste) werden weiterhin außerhalb des Marktes beschafft, sind aber für die Versorgungssicherheit immer wichtiger.
- Langzeitspeicher. Reicht das ESEM aus, um Projekte mit hohen Investitionskosten wie Pumpspeicher zu unterstützen? Das Panel empfiehlt, dass Bundesstaaten außerbörsliche Reserven beschaffen können, um Risiken seltener, schwerwiegender Ereignisse abzufedern – was Zweifel aufkommen lässt.
- Timing. Dies ist ein Entwurf mit „Arbeitsständen“, die in der nächsten Phase konkretisiert werden. Die Konsultation zum Entwurf ist jetzt offen, der Abschlussbericht wird zum Jahresende erwartet.
wendel@modoenergy.com