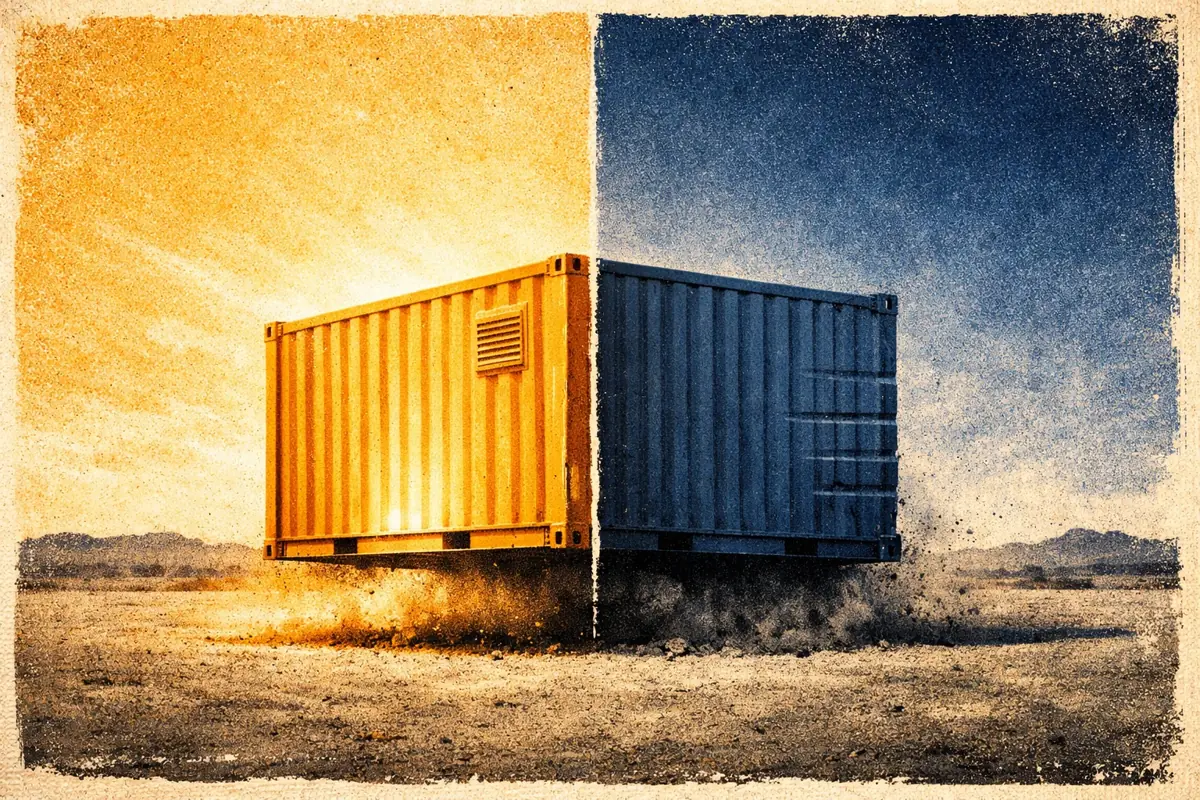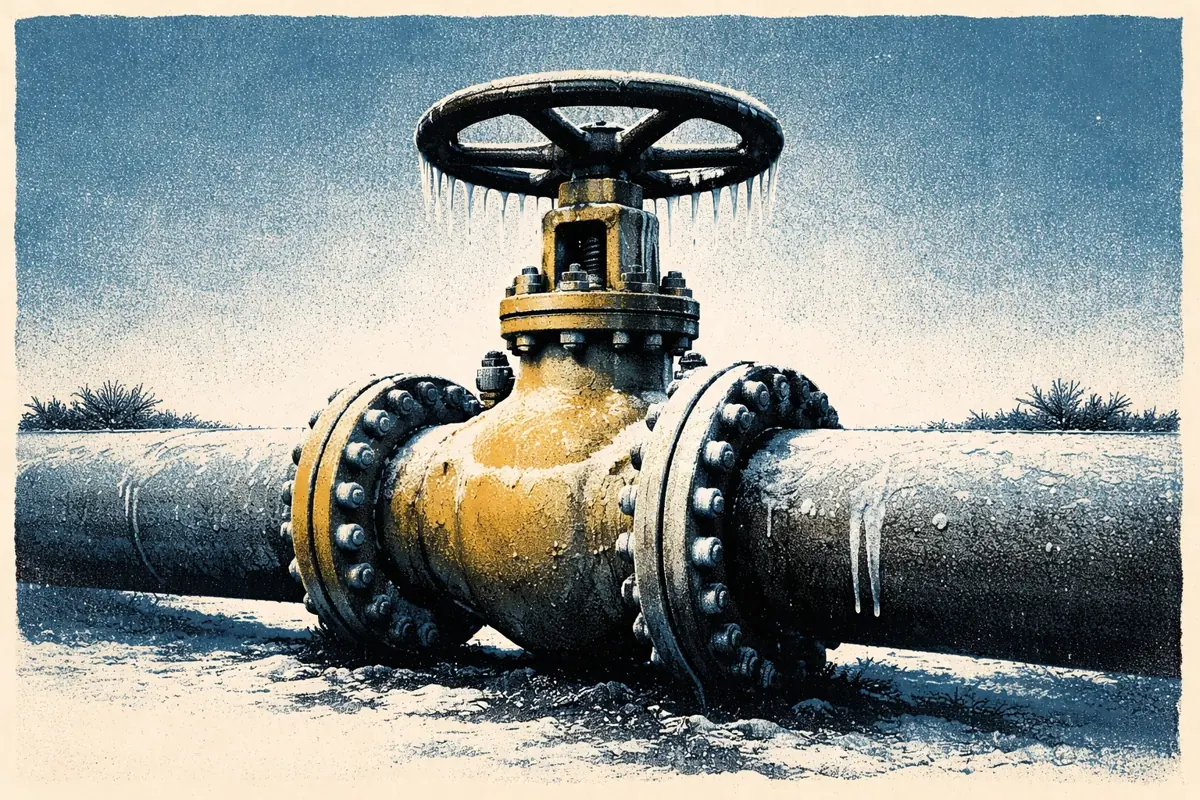Degradation und Zyklen: Wie sie Ihre Batterie beeinflussen
Wie wirkt sich die Degradation auf Ihre Batterie aus? Nun, alle Lithium-Ionen-Batterien verschleißen mit der Nutzung. Das kennen wir von unseren Handys – nach ein paar Jahren hält der Akku nicht mehr so lange durch wie am Anfang.
Das Gleiche gilt für stationäre Batteriespeicher-Anwendungen. Mit der Zeit verschleißt das System. Dadurch verringert sich die Gesamtenergiemenge, die das System speichern kann. Aber was verursacht diese Degradation?
Um Degradation zu verstehen, müssen wir zu den Grundlagen zurückkehren. Zeit für eine kurze Chemie-Stunde!
Chemie 101: Wie funktioniert eine Lithium-Ionen-Batterie?
Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus einer Anode (meist Graphit), einer Lithium-basierten Kathode (häufig Lithium-Eisenphosphat (LFP) oder Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)) und einem flüssigen Elektrolyten, der beide trennt.
Beim Entladen der Batterie bewegen sich positiv geladene Lithium-Ionen von der negativen Anode zur positiven Kathode durch den Elektrolyten. Diese Bewegung der Ionen verursacht einen Elektronenfluss in die entgegengesetzte Richtung, wodurch ein Strom und somit Elektrizität erzeugt wird. Beim Laden läuft der Prozess umgekehrt ab, die Ionen wandern von der Kathode zurück zur Anode.

Warum führt dieser Prozess zur Degradation?
Dieser chemische Prozess findet bei jedem Lade- und Entladevorgang statt. Dabei verändern sich die physikalischen Eigenschaften der Batterie, was zur Degradation führt.
Als Erstes bildet sich eine Solid-Electrolyte Interphase (SEI)-Schicht auf der Oberfläche der Anode. Dies geschieht, weil der flüssige Elektrolyt beim Kontakt mit der Anode teilweise erstarrt.
Diese Schicht fängt Lithium-Ionen ein und verhindert deren freien Fluss zwischen Anode und Kathode. Dadurch reduziert sich die Energiemenge, die die Batterie speichern und abgeben kann.
Ein weiterer Grund für Degradation ist das Lithium-Plating. Dabei bildet sich metallisches Lithium auf der Oberfläche der Anode, wenn es nicht mehr aufgenommen werden kann. Dadurch werden weitere Lithium-Ionen gebunden und die SEI-Schicht kann wachsen, was die Kapazität zusätzlich verringert.
Übermäßiges Lithium-Plating kann auch zur Bildung von Dendriten führen. Diese Ansammlungen von metallischem Lithium können die Batterie physisch beschädigen und sogar zu gravierenden Ausfällen führen.
Wie verändert sich die Degradation mit der Nutzung?
In gewissem Maße altert jede Batterie ständig. Doch mit jedem Lade- oder Entladevorgang nimmt die Degradation zu.
Lade- und Entladevorgänge werden in Zyklen gemessen – ein Zyklus entspricht einer vollständigen Entladung der Batteriekapazität.
Dies kann auf einmal erfolgen (z. B. beim Großhandel), oder in mehreren, kleineren Entladungen über einen längeren Zeitraum (z. B. beim Bereitstellen von Netzfrequenzdiensten).
Je mehr Zyklen eine Batterie durchläuft, desto stärker ist sie degradiert. Abbildung 2 (unten) zeigt beispielhafte Degradationskurven für ein Batteriespeichersystem bei unterschiedlichen Zyklusraten.

Oft tritt die stärkste Degradation zu Beginn der Nutzung auf – bis zu 10 % Kapazitätsverlust allein im ersten Jahr sind möglich. Die Zellchemie, verwendete Materialien und die Fertigungsqualität bestimmen das Ausmaß der Degradation.
Gibt es bestimmte Faktoren, die die Degradation verstärken?
Degradation tritt zwar auch passiv auf, verschlimmert sich jedoch mit jeder Nutzung. Bestimmte Nutzungsarten beschleunigen den Alterungsprozess besonders stark:
- Hochleistungsbetrieb (z. B. maximale Leistungsabgabe).
- Hohe Entladetiefe (z. B. vollständige Entladung von voll bis leer).
- Betrieb an extremen Ladezuständen.
- Betrieb bei extremen Temperaturen.
Wer diese Betriebsarten vermeidet, kann die Degradation reduzieren. In der Praxis gibt es jedoch meist Schutzmechanismen, die die schädlichsten Vorgänge verhindern (z. B. Begrenzungen des maximalen Ladezustands).
Wie wirkt sich das auf die Einnahmen aus?
Es ist wichtig zu verstehen, wie sich die Degradation auf die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern auswirkt.
Großhandelsgeschäfte
Mit der Zeit sinkt durch die Degradation die nutzbare Energiekapazität, sodass weniger Energie verkauft werden kann. Dadurch verringert sich der erzielbare Wert im Handel.
Systemdienstleistungen
Auch die effektive Einsatzdauer des Systems sinkt. Dadurch können bestimmte Systemdienstleistungen nicht mehr mit der gleichen Leistung erbracht werden.
Dies tritt jedoch erst ab bestimmten Schwellenwerten auf – zum Beispiel kann „Dynamic Containment“ bereits mit 30 Minuten Speicherdauer vollständig erbracht werden, während „Dynamic Regulation“ eine Dauer von 2 Stunden erfordert.

Kapazitätsmarkt
Auch Kapazitätsmarktverträge können von der Degradation betroffen sein. Batteriespeicher mit T-4-Verträgen müssen „erweiterte Leistungstests“ bestehen und ihre Fähigkeit nachweisen, die vertraglich vereinbarte Leistung über die geforderte Dauer zu liefern. Durch Degradation kann es bei 15-Jahres-Verträgen passieren, dass die Batterie diese Tests in späteren Jahren nicht mehr besteht.
Bei längerfristigen Projekten kann eine Zellerneuerung erforderlich werden, um die durch Degradation verlorene Speicherkapazität wiederherzustellen.
Wie hängt das mit Garantien zusammen?
Batteriespeichersysteme werden mit einer Garantie geliefert – also einer Zusicherung des Herstellers, dass ein gewisser Grad an Degradation nicht überschritten wird, solange das System innerhalb bestimmter Grenzen betrieben wird.
In der Regel ist eine maximale Anzahl an Zyklen pro Jahr festgelegt – manchmal auch pro Tag, oder es gibt Einschränkungen bezüglich der Betriebszeiten bei bestimmten Ladezuständen oder andere Vorgaben. Das Management dieser bei gleichzeitiger Maximierung der Einnahmen ist eine der wichtigsten Aufgaben beim Betrieb eines Batteriespeichers.
Da die Garantie vor übermäßiger Degradation schützt, ist deren Einhaltung einer der wichtigsten Aspekte beim Betrieb eines Batteriespeichers. Die Verhandlung von Garantien ist daher ein zentraler Teil der Beschaffung von Batteriespeicher-Anlagen.